Kurzbeiträge wissen + forschen 2017
Weitere Kurzbeiträge auf einen Blick finden Sie hier
-
Genetische Barcodes | Leukämien besser entschlüsseln
Genetische Barcodes
Leukämien besser entschlüsseln
Es gibt viele verschiedene Formen von Leukämie – nicht alle sind bis heute genauestens erforscht. Um ihre Entstehung sowie deren Mechanismen besser zu verstehen, nutzen Wissenschaftler moderne Gentransfermethoden, die es ermöglichen, einzelne Zellen genetisch eindeutig zu markieren und ihre Entwicklung exakt zu verfolgen. Kennt man die zelluläre Komposition des Blutes, lassen sich Störungen des Gleichgewichts viel leichter aufspüren. Ein solches hochauflösendes Markierungssystem stellen die genetischen Barcodes dar.
Detektor für LeukämienEin natürlicher Code stellt die Basenabfolge auf der DNA dar: Hier wird die Sequenzinformation für Proteine codiert. Darauf basierend wurden genetische Barcodes entwickelt, die analog zum Barcode auf Supermarktprodukten eine eindeutige Kennzeichnung von Zellen liefern. Diese nutzen die Forscher um Biochemikerin Dr. Kerstin Cornils, Forschungsinstitut Kinderkrebs-Zentrum, zur klonalen Analyse, um die Entwicklung und den Verlauf von Leukämien besser zu verstehen. „Indem wir mit genetischen Barcodes markierte Zellen einschleusen, erhalten wir genaue Erkenntnisse über die Zusammensetzung des Blutes und damit die Entstehung einer Blutkrebserkrankung“, erläutert Dr. Cornils. Die Untersuchungen laufen in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus dem UKE und der TU Dresden, ein gemeinsames Projekt wird von der Deutschen Krebshilfe gefördert.
-
Bei Chemo- oder Radiotherapie | Stromazellen schalten Nebenwirkungen aus
Bei Chemo- oder Radiotherapie
Stromazellen schalten Nebenwirkungen aus
Ganzkörperbestrahlung und Chemotherapie gehören in der hämatologischen und internistischen Onkologie zu den gängigen Vorbehandlungen, um Tumorzellen zu beseitigen. Allerdings sind diese Methoden mit starken, teils lebensbedrohlichen Nebenwirkungen verbunden, indem sie die Blutbildung schädigen (Myelosuppression). Untersuchungen einer UCCH-Forschungsgruppe unter Leitung von Priv.-Doz. Dr. Claudia Lange, Klinik für Stammzelltransplantation, haben gezeigt, dass sogenannte mesenchymale Stromazellen aus dem Knochenmark helfen können, die negativen Effekte einer Bestrahlung auszuschalten.
Blutzellen überlistenIn Modellversuchen beobachteten die Wissenschaftler, dass die transplantierten Stromazellen Substanzen abgeben, die die Erholung der Zellen stimulieren. Weitere Experimente zeigten, dass sogenannte extrazelluläre Vesikel (EV), welche von Stromazellen abgesondert werden, für diesen positiven Effekt verantwortlich sind. „Diese stimulierenden Substanzen wollen wir genauer charakterisieren, um ein zellfreies Produkt gegen eine folgenschwer verlaufende Myelosuppression nach Radio- und Chemotherapie zu entwickeln“, erläutert Dr. Lange die von der Deutschen Krebshilfe unterstützten Forschungsziele der Gruppe. Die Ergebnisse eröffnen neue unterstützende Therapieoptionen für Krebspatienten. So könnten potentielle Nebenwirkungen von Zelltherapien verhindert werden, ohne die regenerative Wirkung der Ursprungszellen einzubüßen.
-
Bewegliche Tumorzellen | Motilität stoppen, Metastasen hemmen
Bewegliche Tumorzellen
Motilität stoppen, Metastasen hemmen
Krebserkrankungen sind besonders gefährlich, wenn sich Tumorzellen in anderen Körperregionen ausbreiten und Metastasen bilden. „Im Gegensatz zu den Zellen des Primärtumors sind metastasierende Zellen äußerst beweglich – diesen Prozess der Tumorzellmotilität wollen wir aufklären“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Sabine Windhorst, Institut für Biochemie und Signaltransduktion. Ziel ihrer Forschungsgruppe ist es, Proteine zu identifizieren, die diesen Verlauf in Gang setzen. „Wir könnten dann spezifische Inhibitoren gegen diese Proteine einsetzen, um die Metastasierung von Tumorzellen zu hemmen“, so Dr. Windhorst.
Erste Proteine identifiziertUm sich bewegen zu können, ordnen die Zellen zunächst ihr Skelett um. Dieser Prozess wird durch sogenannte Zytoskelett modifizierende Proteine (ZMPs) kontrolliert. Zwei solcher ZMPs konnten die Wissenschaftler bereits identifizieren: ITPKA ist essentiell für die Metastasierung von Lungenkarzinomzellen und DIAPH1 für die Metastasierung von Kolonkarzinomzellen. Auch Hemmstoffe gegen die Aktivität von ITPKA haben die Wissenschaftler bereits bestimmt; nun planen sie, diese für die klinische Anwendbarkeit zu optimieren.
Die Forschungsarbeiten basieren auf engen Kooperationen unter anderem mit der Klinik für Allgemein-, Viszeralund Thoraxchirurgie, dem Institut für Pathologie, dem Institut für molekulare Neurogenetik und dem Institut für Mikrobiologie, Virologie und Hygiene.
-
Maßgeschneiderte Krebstherapien entwickeln | Krebszellen gezielt ausschalten
Maßgeschneiderte Krebstherapien entwickeln
Krebszellen gezielt ausschalten
Jede Krebserkrankung ist einzigartig. Selbst bei ähnlichen Krankheitsstadien oder -verläufen bestehen je nach Patient gravierende molekulare Unterschiede. Neue molekularbiologische Verfahren ermöglichen es heute, Tumorerkrankungen viel differenzierter wahrzunehmen und maßgeschneiderte Therapien zu entwickeln – mit maximalem Behandlungserfolg und möglichst geringen Nebenwirkungen.
Neues Medikament in der Erprobung„Wir wollen neue personalisierte Krebstherapien entwickeln und bestehende zielgerichtete Ansätze durch Überwindung von Resistenz verbessern“, erklärt Prof. Dr. Dr. Sonja Loges, II.Medizinische Klinik und Institut für Tumorbiologie. Mithilfe von Biomarkerstudien sollen außerdem diejenigen Patienten identifiziert werden, die von zielgerichteten Therapien profitieren, um den anderen die Nebenwirkungen einer nicht wirksamen Behandlung zu ersparen. Darüber hinaus haben sich die Wissenschaftler vorgenommen, Tumorgewebe von Patienten zu analysieren, um ihnen die neuesten zielgerichteten Behandlungsansätze im Rahmen der Spezialsprechstunde „Personalisierte Krebstherapie“ zugänglich zu machen. Ein außergewöhnlicher Forschungserfolg: Prof. Loges hat mit ihrem Team einen Hemmstoff zur Behandlung fortgeschrittener Akuter Myeloischer Leukämie (AML) zur klinischen Reife gebracht, der jetzt in einer internationalen, multizentrischen Studie erprobt und auf seine Wirksamkeit geprüft wird.
-
Kopf-Hals-Tumoren | Chirurgie auf dem Prüfstand
Kopf-Hals-Tumoren
Chirurgie auf dem Prüfstand
Im Kopf-Hals-Tumorzentrum des UCCH werden sämtliche Tumoren des Kopf-Hals-Gebietes von Kehlkopf, Rachen und Mundhöhle bis zu Nase, Nasennebenhöhlen und den Speicheldrüsen behandelt. Die aktuellen Therapien sind interdisziplinär angelegt und kombinieren meistens Operation, Radio(chemo)therapie oder Radioimmuntherapie. Während die Effizienz von Radiochemotherapien bereits in randomisierten Studien nachgewiesen werden konnte, liegen zur chirurgischen Behandlung bislang nur wenige multizentrische Studien vor. Eine bundesweit erste klinische Vergleichsstudie des Kopf-Hals-Tumorzentrums namens TopROC soll diese Lücke jetzt schließen.
Kombitherapie versus BestrahlungIm Fokus der randomisierten Studie steht die Behandlung von Plattenepithelkarzinomen des Mundrachenraums. Das Forscherteam um Dr. Chia-Jung Busch wird im Rahmen einer Effektivitätsstudie die Wirksamkeit einer Kombitherapie aus transoraler Operation und Strahlenchemotherapie mit einer alleinigen primären Radiochemotherapie vergleichen. „Wir wollen zeigen, dass Operationen onkologisch und funktionell gute Resultate erbringen und maßgeblich für Tumorkontrolle und Lebensqualität der Patienten sind.“ Geklärt werden soll außerdem, ob einer der Therapieansätze in der klinischen Routine den anderen überlegen ist. 280 Patienten sollen in den nächsten zwei Jahren im Rahmen der Studie behandelt werden. An der Vergleichsstudie beteiligen sich 30 Zentren aus ganz Deutschland.
-
Mundhöhlenkarzinome | Längeres Überleben, mehr Lebensqualität
Mundhöhlenkarzinome
Längeres Überleben, mehr Lebensqualität
Im interdisziplinären Tumorboard des UKE kommt wöchentlich ein Team aus Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen, Hals-, Nasen- und Ohrenärzten, Radiologen, Pathologen, Onkologen und Strahlentherapeuten zusammen, um ganzheitliche Therapieoptionen für Patienten mit Kopf-Hals-Tumoren auszuloten. In einer monozentrischen Studie, in der Therapieergebnisse von Patienten mit Mundhöhlenkarzinom verglichen werden, kam heraus, dass die Patienten, die nach Empfehlung des Tumorboards mit einer individuell angepassten Therapie behandelt wurden, länger überlebten und weniger Nebenwirkungen hatten als die ohne individuelle Empfehlung behandelten Patienten.
Wirksamkeit prüfen und optimierenDarüber hinaus gibt es neue Möglichkeiten aus der Molekularbiologie: „Um Tumoren künftig besser charakterisieren zu können, untersuchen wir Gewebeproben von 1000 Mundhöhlenkarzinomen im Rahmen einer multizentrischen Biomarker-Studie“, sagt Dr. Clarissa Precht, Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Man wolle bestimmte Biomarker mit dem klinischen Verlauf von Erkrankungen in Zusammenhang bringen, um die Therapiewirksamkeit zu prüfen und gegebenenfalls zu optimieren.
Auch in der Kiefer-Wiederherstellungschirurgie nach Tumorentfernung wurden Fortschritte erzielt. Mit computergestützten Verfahren kann das passende Knochenimplantat bereits vor der OP geplant werden, wodurch sich das Komplikationsrisiko deutlich verringert.
-
Neues Screening-Programm im Test | Schnelle Hilfe für Krebspatienten
Neues Screening-Programm im Test
Schnelle Hilfe für Krebspatienten
Die psychische Belastung von Krebspatienten wird von onkologischen Behandlungsteams nicht immer ausreichend erkannt, sodass entsprechende Hilfsangebote ausbleiben. Um Unterstützungsbedürfnisse von Patienten frühzeitig zu erkennen, testete eine Projektgruppe um Leon Sautier, Institut und Poliklinik für Medizinische Psychologie, das Elektronische Psychoonkologische Adaptive Screeningprogramm (EPAS) – eine Software, die auf Basis diverser Testverfahren bestimmt, inwieweit ein Patient spezieller Beratung oder Betreuung bedarf.
Enges Sicherheitsnetz für BetroffeneEine vorab durchgeführte Befragung von mehr als 300 im UCCH behandelten Patienten ergab, dass der subjektive Bedarf nach psychoonkologischer Unterstützung mit 42 Prozent doppelt so hoch ist wie die Inanspruchnahme eines psychoonkologischen Angebots (19 Prozent). In einer folgenden Vergleichsstudie zwischen rund 350 EPAS-befragten Patienten und 350 Patienten der onkologischen Routineversorgung stellte sich heraus, dass die EPAS-Patienten deutlich informierter über bestehende Unterstützungsangebote waren. „Darüber hinaus erfuhren wir, dass Patienten, die das Programm nutzten, signifikant häufiger psychoonkologische Hilfe in Anspruch nahmen und von Ärzten häufiger auf ihre psychische Belastung angesprochen wurden“, ergänzt Psychologe Sautier. Ziel der Software ist es, unterstützungsbedürftige Patienten schnell und effizient zu erkennen.
-
HIT-MED Studienzentrale | Kindliche Hirntumoren besser verstehen
HIT-MED Studienzentrale
Kindliche Hirntumoren besser verstehen
Die internationale Studie PNET 5 MB untersucht Kleinhirntumoren und Medulloblastome bei Kindern – koordiniert von der HIT-MED Studienzentrale im UKE. „Wir erforschen, ob Reduktionen in der Strahlen- und Chemotherapie den gleichen Heilungserfolg haben wie herkömmliche Standardtherapien“, erklärt Prof. Dr. Stefan Rutkowski, Direktor der Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie. Zudem wird untersucht, ob die zusätzliche Gabe eines Chemotherapeutikums bessere Heilungsergebnisse erzielt. Neben 59 Zentren in Deutschland sind Prüfzentren in 16 weiteren europäischen Ländern beteiligt. Jetzt soll eine ebenfalls von der Studienzentrale koordinierte deutschlandweite Studie zur Behandlung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit einem sogenannten Ependymom im Zentralen Nervensystem (ZNS) starten.
Enge ZusammenarbeitDie HIT-MED Studienzentrale kooperiert eng mit der Forschungsgruppe von Prof. Dr. Ulrich Schüller aus dem Forschungsinstitut Kinderkrebs-Zentrum Hamburg, der kürzlich eine Stiftungsprofessor für Molekulare Pädiatrische Neuroonkologie angetreten hat. „Wir beschäftigen uns unter anderem mit der Frage, von welchen Zellen kindliche Gehirntumoren ausgehen“, erläutert Prof. Schüller. Gemeinsam baut das Team das Projekt zum neurokognitiven Training weiter aus. Hier wollen Psychologin Dr. Anna Mascherek und Ergotherapeutin Julia Kastenbauer Kindern mit kognitiven Spätfolgen Strategien vermitteln, um Defizite gezielt auszugleichen.
-
Keimzelltumoren des Mannes | Rückfälle verhindern, Spätfolgen reduzieren
Keimzelltumoren des Mannes
Rückfälle verhindern, Spätfolgen reduzieren
Patienten mit metastasierenden Keimzelltumoren des Hodens haben heute sehr gute Heilungschancen. Durch eine Kombinationschemotherapie und gegebenenfalls eine nachfolgende Resektion von Resttumoren werden viele Patienten langfristig tumorfrei. Die interdisziplinäre und multizentrische Arbeitsgruppe Keimzelltumoren des Mannes um Prof. Dr. Carsten Bokemeyer, Direktor der II. Medizinischen Klinik und UCCH-Sprecher, erforscht wesentliche Aspekte zur Biologie und Therapie betroffener Patienten. In experimentellen Studien versuchen die Wissenschaftler zu verstehen, warum Patienten unterschiedlich auf Chemotherapien ansprechen. Darüber hinaus werden molekulare Mechanismen neuer Therapeutika untersucht.
Neue Strategien entwickeln„Aus klinischer Sicht beschäftigt uns aktuell die Frage, wie wir Therapiestrategien für Patienten, die einen Rückfall erleiden, weiter verbessern können“, erläutert Prof. Bokemeyer. Zu den aktuellen Projekten gehören die Untersuchung des Risikos der Entstehung von Thrombosen, die Entwicklung von Prognosemarkern sowie optimale Nachsorgekonzepte. Mögliche Spätfolgen sehen die Forscher aufgrund der guten Heilungsraten als besondere Herausforderung. Auch hierzu laufen diverse Studien mit interdisziplinären Partnern, um gesundheitlichen Konsequenzen bereits während der Therapie vorzubeugen. Prof. Bokemeyer: „Mit mehr als 50 hochrangigen Publikationen in den letzten zehn Jahren zählt die Arbeitsgruppe Hodentumoren zu unseren sehr aktiven Forschergruppen.“
-
Knochenmetastasen bei Brustkrebs | Molekulare Mechanismen im Blick
Knochenmetastasen bei Brustkrebs
Molekulare Mechanismen im Blick
Bei etwa jeder vierten Brustkrebspatientin bilden sich im Verlauf der Erkrankung Metastasen in anderen Körperregionen. Besonders häufig siedeln sich die Tochtergeschwülste in den Knochen an und stören dort das empfindliche Gleichgewicht zwischen Knochenabbau (Osteoklasten) und Knochenaufbau (Osteoblasten). Zwar gibt es Therapien, um den Knochenabbau zu hemmen – aber keine, um zerstörte Knochensubstanz wieder herzustellen.
Lernen zu verstehen„Die meisten Patientinnen sterben nicht an ihrem Primärtumor, sondern an den Metastasen“, erklärt Prof. Dr. Dr. Eric Hesse, Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie. Daher sei es dringend notwendig, neue Behandlungsoptionen zu entwickeln, um die Lebenserwartung zu verbessern. Die Forschungen von Prof. Hesse und seinem Team zielen zunächst darauf ab, die Rolle der knochenaufbauenden Osteoblasten bei der Entstehung von Knochenmetastasen genauer zu verstehen. Dies soll durch verschiedene experimentelle Ansätze wie In-vitro-Experimente oder Hochdurchsatzsequenzierung untersucht werden. Dadurch erhoffen sich die Wissenschaftler aus dem UKE einen genaueren Einblick in die molekularen und zellulären Mechanismen, um langfristig neue Therapien entwickeln zu können. Gefördert wird das Projekt durch das Heisenberg Programm und das Emmy Nöther Programm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG).
-
Hirnmetastasen nach Brustkrebs | Neue Task Force im UKE gegründet
Hirnmetastasen nach Brustkrebs
Neue Task Force im UKE gegründet
Ärzte haben in den vergangenen Jahren eine steigende Inzidenz von Hirnmetastasen bei Brustkrebs-Patientinnen beobachtet. Die meisten Frauen überleben nach Diagnosestellung trotz neurochirurgischer Eingriffe und Bestrahlung weniger als ein Jahr. „Damit gehören zerebrale Metastasierungen zu den drängendsten klinischen Problemen in der Therapie des Mammakarzinoms“, sagt Prof. Dr. Volkmar Müller, Klinik für Gynäkologie. Trotz intensiver Forschung bleiben viele Fragen offen: Wie kommt es zu Metastasierungen im Gehirn? Können effektive Biomarker etabliert werden, um zerebrale Metastasen vorherzusagen?
Interdisziplinäres NetzwerkUm Antworten auf die drängendsten Fragen zu finden, haben verschiedene Kliniken und Institute des UKE auf Initiative der Klinik für Gynäkologie die interdisziplinäre „Task Force Hirnmetastasen“gebildet. Die interdisziplinäre Gruppe, zu der unter anderem auch Strahlentherapeuten, Neurochirurgen, -radiologen und -pathologen gehören, diskutiert laufende Projekte in regelmäßigen Treffen und versucht Strategien zu entwickeln, um die Versorgungssituation der betroffenen Frauen zu verbessern. In der Registerstudie „Brain Metastases in Brest Cancer Network Germany“ (BMBC-Register) werden in einem bundesweiten Projekt Daten zu klinischen Verläufen von Brustkrebs-Patientinnen mit Hirnmetastasen gesammelt, um den Stand der Behandlung dieser fortgeschrittenen Erkrankung besser zu verstehen. Aktuell sind im Register bereits die Krankheitsverläufe von etwa 1700 Patientinnen erfasst.
-
Akute Myeloische Leukämie | Rückfälle verstehen – und verhindern
Akute Myeloische Leukämie
Rückfälle verstehen – und verhindern
Die Akute Myeloische Leukämie (AML) ist die aggressivste Form von Blutkrebs im Erwachsenenalter; sie erfodert eine intensive Chemotherapie. Zwar werden die meisten Patienten scheinbar komplett geheilt. Doch bei der Hälfte flammt die Erkrankung nach wenigen Monaten oder Jahren erneut auf und ist dann meistens nicht mehr beherrschbar. Wie es möglich ist, dass die Leukämie trotz kompletter Heilung zurückkehrt, will ein Forscherteam der Arbeitsgruppe Akute Leukämien um Dr. Jasmin Wellbrock und Prof. Dr. Walter Fiedler, beide II. Medizinische Klinik, ergründen.
Signalwege nachvollziehen„Die Behandlung der Leukämie mit Chemotherapeutika lässt sich gut mit der Verfolgung eines Verbrechersyndikats vergleichen: An die Hintermänner kommt man nicht ran“, veranschaulicht Dr. Wellbrock die Problematik. Im Falle der Leukämie seien die wahren Bösewichte die Leukämiestammzellen, die in einer speziellen Nische im Knochenmark sitzen. Diese Nische setzt sich aus verschiedenen Stromazellpopulationen zusammen und bietet den Leukämiezellen so ein geschütztes Umfeld. Ziel der onkologischen Arbeitsgruppe ist es, die komplexen Interaktionen zwischen Leukämie- und Stromazellen zu entschlüsseln, um neue Zielstrukturen für die Leukämietherapie zu identifizieren. Um detaillierte Einblicke in die Pathophysiologie dieser Zellen zu gewinnen, greifen die Forscher auf Material der klinikeigenen AML-Biobank zurück, in der Knochenmark-, Blut- sowie Plasmaproben gesammelt werden.
-
Patienten motivieren Angehörige | Prävention gegen Darmkrebs
Patienten motivieren Angehörige
Prävention gegen Darmkrebs
Das kolorektale Karzinom ist die zweithäufigste Krebserkrankung in der westlichen Welt. Menschen mit familiärer Vorbelastung haben ein zwei- bis vierfach erhöhtes Risiko, an Darmkrebs zu erkranken. Besonders in dieser Gruppe kann rechtzeitige Vorsorge in Form einer Darmspiegelung (Koloskopie) lebensrettend sein. Doch lediglich 20 Prozent der Bevölkerung nehmen das Screening-angebot in Anspruch.
Information schafft MotivationUm insbesondere Verwandte ersten Grades von Darmkrebspatienten zu einer Vorsorgekoloskopie zu bewegen, hat das Forscherteam um Priv.-Doz. Dr. Andreas Block, II. Medizinische Klinik, eine multizentrische Studie entwickelt. „Wir wollen Patienten in strukturierten Aufklärungsgesprächen über familiäre Erkrankungsrisiken und Präventionsmaßnahmen informieren, um darüber ihre erstgradigen Verwandten zu erreichen“, erläutert Dr. Block. Seit Juni 2014 nahmen mehr als 200 Patienten in sieben norddeutschen Darmkrebszentren an der Studie teil. Erste Ergebnisse untermauern den Erfolg: Mit bislang 100 Patienteninterviews konnten 260 erstgradige Verwandte erreicht werden; das Vorsorgeverhalten der nahen Angehörigen stieg nach nur sechs Monaten signifikant an. Dr. Block: „Die Studie zeigt eindrucksvoll, wie sich unter Einbindung der Patienten die Krebsprävention einfach und effektiv verbessern lässt und dadurch hohe Folge- und Therapiekosten vermieden werden können.“
-
Gastrointestinale Tumoren | Gemeinsam die beste Therapie finden
Gastrointestinale Tumoren
Gemeinsam die beste Therapie finden
Tumorerkrankungen können heute gezielter und wirkungsvoller behandelt werden als noch vor wenigen Jahren. Grund hierfür: Wissenschaftler entdeckten in der jüngeren Vergangenheit molekulare Besonderheiten von Tumorzellen – etwa veränderte Signalübertragungswege innerhalb der Zellen oder auch das Vorhandensein sogenannter Oberflächenrezeptoren. Die klinische Erforschung von zielgerichteten Medikamenten findet häufig im Rahmen großer, internationaler Studien statt. Da diese molekularen Veränderungen jedoch nur bei sehr wenigen Patienten auftreten, hat das Universitäre Cancer Center Hamburg (UCCH) ein „Hamburger Netzwerk für zielgerichtete Therapie“ gegründet, um den Patienten den Zugang zu innovativen Behandlungsmethoden zu ermöglichen.
UKE und Praxen im engen AustauschZu dem Netzwerk gehören neben dem Onkologischen Zentrum des UKE die Hämatologisch-Onkologische Praxis Altona (HOPA), die Hämatologisch-Onkologische Praxis Eppendorf (hope) sowie die Gemeinschaftspraxen Verpoort/ Wierecky/Zeller und Müller-Hagen/Bertram. „Wir suchen im engen Austausch bei möglichst vielen Patienten nach diesen molekularen Veränderungen und bieten ihnen dann innerhalb des Netzwerks die Teilnahme an einer entsprechenden Studie mit zielgerichteten Medikamenten an“, sagt Priv.-Doz. Dr. Alexander Stein, II. Medizinische Klinik, der Ansprechpartner des UCCH für das neue Netzwerk ist. Weitere Infos unter www.uke.de/ucch, Kooperationen.
-
Substanzen aus dem Meer | Resistenzen überwinden
Substanzen aus dem Meer
Resistenzen überwinden
Zu den bösartigen Tumoren des Urogenitalsystems gehören Karzinome der Blase, der Hoden und Nieren sowie der Prostata. Problematisch ist es, wenn Patienten Resistenzen gegen Standardtherapien wie Chemo- oder Strahlentherapien entwickeln. „Deshalb analysieren wir seit einigen Jahren zusammen mit unserem russischen Kooperationspartner aus Wladiwostok neue marine Wirkstoffe, die aus Meereslebewesen wie Seegurken oder Schwämmen isoliert werden, auf ihre Effektivität und Toxizität“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Gunhild von Amsberg, II. Medizinische Klinik des UKE.
Aktive WirkstoffeZiel der Wissenschaftler ist es, neue Substanzen zu finden, um Resistenzen gegen klassische Behandlungsansätze zu überwinden. Einen wesentlichen Mechanismus der marinen Wirkstoffe konnten die Forscher bereits identifizieren: die Hemmung der Pro-Survival-Autophagie. „Dabei handelt es sich um die gezielte Selbstauflösung der Zelle. Sie entsteht, wenn Zellen einem schädigenden Einfluss ausgesetzt sind“, so von Amsberg. Im Falle von Tumorzellen seien dies Radio- oder Chemotherapien. Dabei schützt Pro-Survival-Autophagie die Krebszellen und kann so zu einer Resistenzentwicklung führen. Mit marinen Wirkstoffen gelingt es, diesen Vorgang zu hemmen und damit der Zellresistenz entgegenzusteuern. Zudem können die marinen Wirkstoffe selbst das Absterben der Tumorzellen auslösen. Durch diese einzigartige Wirkkombination bleiben die Substanzen auch dann aktiv, wenn aktuelle Behandlungsmethoden versagen.

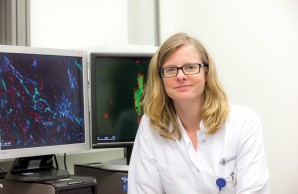
_contentbild2.jpg)

_contentbild2.jpg)